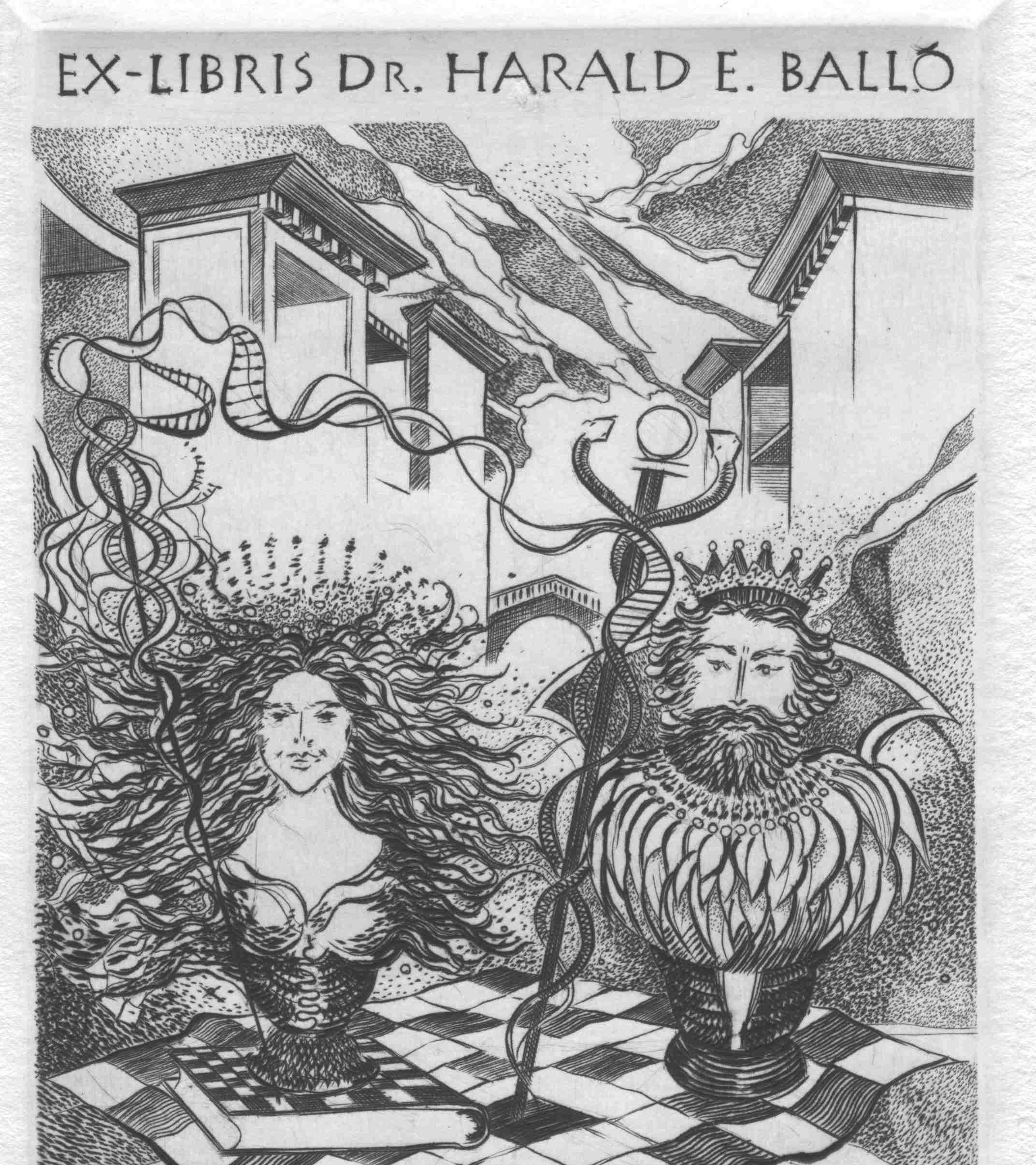Die Antiquiertheit der Schachwunderkinder
Als ich gefragt wurde, ob ich einen Artikel über Wunderkinder im Schach (dieser Artikel erschien in abgeänderter Form mit Bildmaterial in der Dreimonatsschachschrift KARL Nr. 4 im Dezember 2001, S. 16-24) für das letzte, im Dezember 2001 erscheinende KARL-Heft schreiben wolle, war ich zunächst skeptisch dies einigermaßen vernünftig bewerkstelligen zu können (der Leser mag entscheiden, ob es mir schließlich gelungen ist). Zu sehr war und ist mir schon der Begriff des Wunderkindes suspekt und um es vorwegzunehmen: Für mich gibt es keine Wunderkinder.
Der Begriff Wunderkinder atmet die Antiquiertheit vergangener Zeiten, in denen Säkularisation und wissenschaftlicher Fortschritt die Welt noch nicht erhellte. Allenfalls könnte man mit einiger Berechtigung von einer besonderen Begabung zum Schachspiel sprechen. Mir scheint es deshalb besser, und ich werde nach einigen einleitenden Worten darauf zurückkommen, von Menschen zu sprechen, die schon in sehr jungen Jahren, eine wirklich außergewöhnliche Schachbegabung zeigten.
Doch der Reihe nach: Laut Brockhaus (Der Große Brockhaus, 15. Auflage, Leipzig 1935) bezeichnet „Wunder“ ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen oder Ereignis. In allen Religionen wird das Wunder als Zeichen der (allumfassenden) göttlichen Macht gedeutet und als Geheimnis erfahren, das über der Welt liegt. Katholische Theologen verstehen das Wunder als Geschehen, das sich nicht aus den physikalischen Gesetzen der Natur erklären lässt und deshalb Gott als dessen übernatürlichen Verursacher annimmt. Im Neuen Testament steht es meist im Zusammenhang mit der Verkündigung Jesu. Zwar prägte der Protestantismus die Einstellung zum Wunder um, insbesondere auch infolge der neuzeitlichen Wandlungen des wissenschaftlichen Weltbildes, doch bleibt das Wunder auch hier etwas Irrationales, etwas, das durch den Verstand nicht fassbar ist.
Das Russische hat das Wort Wunderkind in seinen Wortschatz aufgenommen und das Englische und Französische, das den deutschen Begriff kennt, ihn aber nicht benutzt, verwendet das aus dem Lateinischen stammende Prodigy bzw. Prodige, das sich von wunderbar bzw. außergewöhnlich herleitet.
Immanuel Kant (1724-1804), der große Meister der Vernunft, meinte „ein frühkluges Wunderkind (ingenium praecox), wie in Lübeck Heinicke oder in Halle Baratier, von ephemerischer (Hemera, griech. ein Tag) Existenz, sind Abschweifungen der Natur von ihrer Regel“ (Susanna Poldauf, pers. Mitteilung). Thomas Mann (1875-1955) läßt einen alten Herrn, der ein Wunderkind anlässlich eines Konzertes in der Oper beim Klavierspiel beobachtet, sagen: „Eigentlich sollte man sich schämen. Man hat es nie über ‚Drei Jäger aus Kurpfalz’ hinausgebracht, und da sitzt man nun als eisgrauer Kerl und lässt sich von diesem Dreikäsehoch Wunderdinge vormachen. Aber man muß bedenken, daß es von oben kommt. Gott verteilt seine Gaben, da ist nichts zu tun, und es ist keine Schande, ein gewöhnlicher Mensch zu sein. Es ist etwas wie mit dem Jesuskind. Man darf sich vor einem Kinde beugen, ohne sich schämen zu müssen. Wie seltsam wohltuend das ist!“ (Thomas Mann, Das Wunderkind, Fischer Verlag, Berlin 1914, S. 19).
Der Begriff des Wunderkindes, dergestalt in’s miraculöse gewendet und das Wunderbare und Außergewöhnliche betonend, scheint mir aber in neuerer Zeit nicht mehr geeignet, das Phänomen frühkindlicher Hochbegabung im Schach ausreichend zu erklären. Schon Adalbert Stifter (1805-1868) zog das Phänomen mehr in’s profan alltägliche als er schrieb: „mir war von jeher blosze Fertigkeit zuwider, und sogennante Wunderkinder machten mir jedes Mal einen Schmerz“ und Schopenhauer gar meinte: „die Wunderkinder werden in der Regel Flachköpfe“ (Susanna Poldauf, pers. Mitteilung). Für sie war die frühkindliche Hochbegabung eben bloße Fertigkeit, die zu erwerben es individuell unterschiedlicher Anstrengung bedarf, wobei der Erfolg dieser Anstrengung bisweilen freilich auch ausbleiben oder erst später kommen kann.
In erster Annäherung ist demgemäß ein Kind dann ein Wunderkind, wenn es weit über seinen normalen geistig-körperlichen Reifegrad hinausreichende Leistungen vollbringt. Doch was ist normal? Normalität im Schach kann zeitbedingt unterschiedliche Leistungsstufen darstellen. Wir werden später noch darauf zurückkommen, doch sei an dieser Stelle bereits beispielhaft angeführt, daß die Leistungen im Schach, die zu Zeiten eines Philidor oder eines Morphy durchaus bewunderungswürdig waren, heute als normal und keineswegs als außergewöhnlich anzusehen sind.
Ich möchte deshalb in zweiter Annäherung eine historisch begründete Unterscheidung schachlicher Hochbegabung im Kindesalter wählen, die zwischen Schachspielern unterscheidet (dabei geht es, nebenbei bemerkt, um das schachpraktische Spiel Mann gegen Mann, das Problemschach sowie das Studien- und Märchenschach bleiben außen vor), deren Schachfertigkeit durch ausgiebiges Training in frühen Kindes- und Jugendjahren, zu außergewöhnlich hohem Niveau gelangt ist und solchen Schachspielern, deren Schachfertigkeit nach den uns vorliegenden geschichtlichen Quellen ohne großes Spezialtraining zur Ausbildung gelangte. Dabei kann es je nach Quellenlage gelegentlich schwierig sein, den Wahrheitsgehalt einer Behauptung zu überprüfen. Beispielsweise mutet die in der Biographie vieler sogenannter Wunderkinder immer wieder gelesene Behauptung unglaubwürdig an, das Kind habe Schach durch bloßes Zuschauen erlernt, scheint sie doch zur Überhöhung des Helden durch seinen Biografen geradezu prädestiniert zu sein.
Es ist dem Autor bewusst, daß diese Unterteilung arbiträr ist, denn sie gründet sich nicht auf ein wissenschaftsbasiertes System zur Ergründung des für das Schachspiel spezifischen Denkens oder der Lerntheorie allgemein, hier muß auf die ausgiebige Spezialliteratur verwiesen werden, sondern sie ist insofern eine bloß historische Unterscheidung, als die pädagogischen und lerntheoretischen Methoden zur Herausbildung von Höchstleistungen bei Kindern und Jugendlichen im Schach und auf anderen Gebieten erst in unserer Zeit, d.h. in den letzten 50 Jahren, entwickelt wurden und die in den Zeiten des kalten Krieges auch von „Staats wegen“ instrumentalisiert wurden, um die Überlegenheit eines Systems zu beweisen. Kinder wie Olga Korbut, die Turnerin, und andere Kinder mit sportlichen Höchstleistungen geben hierfür ein gutes Beispiel und gerade das Schach, das irrtümlicherweise weithin ob seines angeblich hohen Gehaltes an Intellektualität und seines erhabenen Geistes angesehen ist, wurde in der Sowjetunion u.a. dank der Arbeiten eines Michail Botwinnik dazu benutzt, solcherart Überlegenheit zu beweisen.
Mit derlei „Spezialistentum“ ist mancherlei Staat zu machen und beginnt man nur früh genug, stellen sich Erfolg, aber auch Misserfolg alsbald heraus. So sagte schon Auguste Tissot, ein Arzt aus dem 18. Jahrhundert: „die Würkungen des Studierens sind nach dem Alter in welchem man sich demselben überlässt, sehr verschieden; ein anhaltender Fleiß ist in der Kindheit tödlich. Ich habe Kinder voll Geistes gekannt, die mit dieser weit über ihr Alter gehenden gelehrten Raserey befallen waren, und ich habe mit Schmerzen das Schicksal, das auf sie wartet, vorausgesehen; im Anfang sind sie Wunder, am Ende Narren“ (Susanna Poldauf, pers. Mitteilung).
Es ist nach dem oben dargelegten einleuchtend, daß mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts und der Einführung lerntheoretisch begründeter „Spezialausbildungen“ von Kindern, der Begriff des Schachwunderkindes fehl am Platze und antiquiert ist. Ich unterscheide deshalb zwischen dem Schachwunderkind im eigentlichen Sinne, nämlich der schachlichen Hochbegabung im Kindesalter vor dem Aufkommen besonderer lerntheoretischer Konzepte einerseits und der schachlichen Hochbegabung im Kindesalter in der Neuzeit andererseits.
Der erste, der sich mit schachlicher Begabung und hier insbesondere dem Blindspiel beschäftigte, war der französische Experimentalpsychologe Alfred Binet (1857-1911) (Alfred Binet, Psychologie des grands Calculateurs et Joueur d’Échecs. Hachette Paris, 1894. Eine partielle deutsche Übersetzung erschien unter dem Titel: Das Gedächtnis der Schachspieler. Eine psychologische Studie über das Blindspiel. Als Sonderabdruck der „Berliner Schachzeitung, 1. Jahrgang, Verlag Max Günther, Berlin 1896). Binet entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts den ersten weithin zur Anwendung gelangenden Intelligenztest, mit dem 1920 auch der kleine Samuel Reschewsky getestet wurde.
Schauen wir uns nach diesen Vorbemerkungen die folgende Kandidatenliste potentieller Schachwunderkinder einmal an. Es mag sein, daß der eine oder andere Schachspieler oder Schachspielerin nicht aufgeführt ist, das würde aber am Resultat nichts ändern. Es kann nämlich in dem hier dargelegten historischen Sinn nicht sehr viele Schachwunderkinder geben
Kandidatenliste Schachwunderkinder:
Francois Danican genannt Philidor *7.9.1726 +31.8.1795
Paul Morphy *22.6.1837 +10.7.1884
José Capablanca *19.11.1888 +8.3.1942
Samuel Reschewsky *26.11.1911 +1992, GM 1950
Arturo Pomar *1.9.1931, IM 1950, GM 1962
Michael Tal *9.11.1936 +?, GM 1957
Boris Spassky * 30.1.1937; IM 1953, GM 1955
Robert Fischer *9.3.1943; IM 1957, GM 1958
Florin Gheorgiu *6.4.1944, IM 1963, GM 1965
Anatoly Karpow *23.5.1951, IM 1969, GM 1970
Henrique Mecking *1952, IM 1967, GM1972
John Nunn *25.4.1955, IM 1975, GM 1978
Jutta Hempel *27.9.1960
Maja Tschiburdanidse *17.1.1961, WIM 1974, WGM 1977, IM 1978, GM 1984
Zsuzsa Polgar *19.4.1969, WIM 1982, IM 1984, GM ?
Judith Polgar *23.7.1976. IM 1988, GM 1989
Gata Kamsky *
Nigel Short *
Es wird deutlich, daß unter dem antiquierten Begriff des Schachwunderkindes lediglich die ersten vier Schachspieler, nämlich Philidor, Morphy, Capablanca und Reschewsky subsummiert werden können. Wir wollen uns in diesem Teil unserer Ausführungen diesem streng historisch definierten Begriff des Wunderkindes zuwenden und im folgenden auf die vier genannten Schachspieler im Rahmen eines jeweils kurzen biografischen Abrisses näher eingehen und nachweisen, daß sämtliche vier Spieler ohne nennenswerte Vor- und Ausbildung im Schach dieses Spiel besser, ja weitaus besser als ihre Zeitgenossen beherrschten und außergewöhnliche Leistungen vollbrachten.
Wir werden dabei feststellen, daß mit der Person und dem Leben von Samuel Reschewsky die Sinnhaftigkeit der von uns gewählten historischen Einteilung im Hinblick auf schachliche Sonderbegabung deutlich wird, stellt Reschewsky doch quasi das Bindeglied zwischen alter und neuer Zeit dar, indem die Familie Reschewsky, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Wunderkind Sammy durch Europa tourte, die Geschichte der Familie Polgar wenn auch mit einem wichtigen Unterschied vorwegnahm, insofern nämlich als der Vater Polgar das wissenschaftliche Element einführte.
Die Leistungen der anderen hier aufgelisteten Spieler und Spielerinnen zeichnen sich allesamt ebenfalls durch frühe gute bis sehr gute Leistungen im Schach aus, die jedoch sämtlich Auswuchs einer umfangreichen Trainingstätigkeit bzw. Spieltätigkeit und somit Ausdruck eines hochgradigen, antrainierten Spezialistentums sind. Dabei besitzen alle eine außergewöhnliche Begabung zum Schach. Es scheint mir sinnvoll zu sein, in einer weiteren Auseinandersetzung mit diesem Thema, diese Namensliste hinsichtlich des interessierenden Formenkreises der schachlichen Sonderbegabung weiter zu untersuchen. Die Schicksale und Lebensläufe solch unterschiedlicher Menschen wie Mecking, Fischer, Polgar und Nunn sind sicherlich der näheren Betrachtung wert, bieten sie doch schon prima vista Anlaß zu interessanter Spekulation. Dabei sind dann jedoch auch lerntheoretische Konzeptionen und Aspekte der Wissenschaft vom Denken heranzuziehen.
Francois-André Danican genannt Philidor
Philidor wurde am 7. September 1726 in der kleinen Stadt Dreux westlich von Paris als Sohn des André (der Ältere; 1652-1730) Philidor und dessen Frau in zweiter Ehe Elisabeth Leroy (1696-1761) geboren. Philidors Mutter war bei seiner Geburt 28 Jahre alt wohingegen sein Vater bereits 74 Jahre alt war. Der Vater starb als sein Sohn gerade erst vier Jahre alt war.
Francois-André wurde bereits im Alter von sechs Jahren, also früher als gewöhnlich, in das Pagenkorps der königlichen Kapelle von Versailles aufgenommen. Sein Weg als Hofmusiker Ludwigs XV. schien geebnet (Susanna Poldauf, Francois-André Danican Philidor:Musiker und Schachspieler, Magisterarbeit Phil. Fak., Humboldt Univ. Berlin, 1998).
Wir sind über die ersten Lebensjahre von Philidor unter anderem auch durch seine eigenen Angaben, die er seinem Freund Richard Twiss in London lieferte, recht gut informiert. Twiss schenkte ein Exemplar seines Werkes seinem Freund Philidor.
Twiss brachte im Band I eine immerhin 22 seitige Abhandlung: Anecdotes of Mr. Philidor, communicated by himself (Richard Twiss, Chess Band I, London 1787, S. 149 ff.). Darin heißt es (meine Übersetzung aus dem Englischen): „Im Alter von sechs Jahren wurde er unter die Kinder der königlichen Kapelle von Versailles aufgenommen, wo er täglich anwesend sein musste und wo er die Gelegenheit hatte von den wartenden Musikern Schach zu lernen. Es gab etwa 80 Musiker. Das Kartenspiel war so nahe an der Kapelle nicht erlaubt und so hatten sie einen langen Tisch mit eingelegten Schachbrettern, von denen es sechs an der Zahl gab. Im Alter von elf Jahren wurde ein Mottet oder Psalm mit Chören, den er komponiert hatte, aufgeführt, und dies gefiel dem König Louis XV. so sehr, daß er dafür fünf Louisdor erhielt: das ermutigte den Jungen, vier weitere Motetten zu komponieren. Als er vierzehn Jahre alt geworden war, verließ er die Kapelle und hatte dann die Reputation, der beste Schachspieler der Band zu sein“. Weiter teilt Philidor im Band II desselben Werkes mit, und dies soll nur beiläufig erwähnt werden, daß „die Musikkunst zu allen Zeiten Gegenstand seines konstanten Studiums und Eifers war und Schach nur sein Zeitvertreib“ (Richard Twiss, Chess, Band II, 1789, S. 216). Über die Art, wie Philidor Schach gelernt hat, ist im Twiss nichts zu finden (Susanna Poldauf, Philidor, Exzelsior Verlag Berlin, 2001, S. 14 bezieht sich auf Allen, The Life of Philidor, Philadelphia 1858 und Twiss, wenn sie mitteilt, Philidor habe Schach durch bloßes Zuschauen gelernt. Twiss jedoch schreibt darüber gar nichts und Allen wiederum bezieht sich auf den ältesten Sohn Philidors, André, der im Le Palamède, Paris 1847, S. 2 ff. die Geschichte, die auch von Sedaine überliefert wurde, erzählt. Sie stimmt im wesentlichen mit der hier übersetzten Version von Sedaine überein, wenngleich sie doch ein wenig abgewandelt ist. Auf Einzelheiten muß hier aus Raumgründen verzichtet werden.).
Erst die folgende Geschichte aus dem Jahre 1736, Philidor war also neun oder gerade erst zehn Jahre alt geworden, welche von Michel Sedaine, einem französischen Dramatiker (1719-1797) überliefert ist, gibt Auskunft über die schachliche Frühbegabung Philidors, wenngleich auch hier der explizite Hinweis, Philidor habe das Schachspiel durch bloßes Zuschauen gelernt, nicht zu finden ist, aber immerhin mit ein wenig gutem Willen abzuleiten ist. Sedaine war als Theatermann nahe bei den Musikern des Königs und eines Tages wurde ihm von einem der Musiker die folgende Geschichte erzählt: „Das ist ein schönes Abenteuer, das sich gestern morgen im Saal, in dem wir uns treffen bevor wir in die Messe des Königs gehen, ereignete. Es gibt in diesem Saal einen langen Tisch, in den sechs Schachbretter eingelegt sind und wir bringen die Geduld für unser allzu oft sehr langes Warten damit auf, daß wir Schach spielen; wir haben in unserem Orchester den kleinen Philidor, Bruder des Musikers, der öffentliche Konzerte gegeben hat als die Oper geschlossen war; das ist ein kleiner Junge von etwa zehn Jahren, der uns immer sehr aufmerksam beim Spiel zuschaut (das ist der Satz, der als Hinweis dafür gelten kann, daß Philidor beim Zuschauen das Schach gelernt hat, Anm. HEB). Diesen Morgen, traf er zu früher Stunde ein und fand unterdessen den ältesten Musikers unseres Orchesters ganz aufgeregt, da er seinen Kameraden, mit dem er jeden Tag im Schach kämpfte, nicht vorfand. Er schimpfte vor dem Kleinen, daß der, um ihn zu beruhigen, ihm vorschlug, doch gegen ihn zu spielen; ich war gerade dabei einzutreten, als ich den Alten in Gelächter ausbrechen sah, und Philidor ganz rot und voller Scham. Beide setzten sich vor ein Schachbrett, das sich glücklicherweise ausreichend nahe der Türe befand. Die Partie begann. Ich sah ihnen zu, so wie die Kameraden, die nach und nach eintrafen und wir waren bald erstaunt zu sehen, daß sich der Alte anstatt einem Schüler, dem er glaubte eine Lektion erteilen zu können, einem veritablen Gegner gegenüber fand. Seine schlechte Laune verschlechterte sich zusehends weiter und man musste seinen Unmut bei jedem guten Zug des Kleinen sehen und die Unsicherheit desselben, der zweifelte, ob er seinen baldigen Triumph nicht mit einer Ohrfeige bezahlte. Jedesmal schaute er mit einem flehenden Blick zur Tür, so als ob er ihr sage, näher zu kommen, dabei uns gleichzeitig verschmitzt mit den Augen zuzwinkernd. Der Alte, absorbiert durch sein Spiel, sah davon nichts, Philidor rutschte langsam an das Ende der Bank; als er konnte, forcierte er die Züge der Partie, warf einen letzten Blick zur Tür, die er geöffnet sah, avancierte sanft seine entscheidende Figur und schleuderte ein Matt! heraus, aufsehenerregend und höhnisch, und floh mit der ganzen Geschwindigkeit seiner kleinen Beine, um der Verfolgung, die er voraussah zu entkommen. Der gute Mann dachte nicht lange, er war entsetzt: ‚Das ist ein Wunderkind (prodige), dieser Kleine’ wiederholte er in einer Art Entsetzen. Wir sind Philidor suchen gegangen und, nach der Messe des Königs, haben die drei Stärksten von uns ihn herausgefordert; er hat sie alle geschlagen. Es ist dieses Abenteuer, das uns so amüsiert, Sedaine, sie werden sehen, daß man später von ihm reden hört, denn er ist schon ein guter kleiner Musiker; er übt sich, klein wie er ist, bereits in der Komposition. Er ist es, der nie eine Oper unseres berühmten Rameau verpasst, er trillert Menuette und Gavotte (alter französischer Tanz) auf der Straße, dabei Bewegungen und Schritte ausführend, die den Passanten und uns Freude bereiten. Wir lieben ihn sehr, diesen kleinen Jungen“ (E. Guieysse-Frère: Sedaine, ses protecteurs, ses amis, Flammarion Paris, s.d. zitiert nach: Dupont-Danican Philidor, Les Philidor. Une Dynastie de musiciens. Zurfluh Paris, 1995, S. 46-47).
Die gleiche Begebenheit, wenn auch in etwas anderen Worten, schildert der älteste Sohn Philidors, André, im Le Palamède (Le Palamède, Paris 1847, S. 2 ff.) so daß der Wahrheitsgehalt, weil von zwei unabhängigen Quellen kommend, als sicher angesehen werden kann. In beiden Texten wird aus der Passage, Philidor habe vor dem ersten Spiel mit dem Musiker „aufmerksam den Musikern beim Schachspiel zugeschaut“, die Schlußfolgerung gezogen, er habe das Schachspiel nur durch eben dieses Zuschauen gelernt.
Es sind aus dieser Zeit leider keine Partien von Philidor erhalten und die späteren von ihm überlieferten Partien sind der Zeit gemäß, auf niedrigem Niveau, vergleicht man sie mit dem heutigen Schach.
Philidor, das erste Wunderkind im Schach, prägte auch den ersten Merksatz in der Geschichte des Schachs, der da heißt: Die Bauer sind die Seele des Schachspiels. Es ist schwierig hierfür ein Beispiel in seinen Partien zu finden, doch mag die folgende Partieanalyse, die der elektronischen Partiesammlung Megabase 2001 (ChessBase GmbH, Mexikoring 35, Hamburg) entnommen ist, als Beispiel für diesen ersten Merksatz der Schachgeschichte gelten. Sie ist kurzweilig nachzuspielen.
Philidor, Francois-André Danican – Analyse [C23] 1749
1.e4 Während Greco das Schachvolk lehrte die Figuren richtig zu nutzten, erkannte Philidor, daß der richtige Umgang mit den Bauern die Grundlage des Positionsspiels ist.“Die Bauern sind die Seele des Schachspiels.“ 1…e5 2.¥c4 ¥c5 3.c3 ¤f6 4.d4 exd4 5.cxd4 ¥b6 6.¤c3 0–0 7.¤ge2 c6 In dem vorliegenden Übungsbeispiel erläutert Philidor, auf welche Weise man in drei Schritten einen Bauern zur Dame führen kann.1.Schritt: Schaffe Bauernmehrheiten2.Schritt: Schaffe eine Freibauern.3.Schritt: Verwandle den Freibauern zur Dame. 8.¥d3 Weiß bereitet sich auf den Vorstoß d7-d5 vor, ohne seine e-Bauern gegen den schwarzen d-Bauerm tauschen zu müssen.. [8.0–0? d5 9.exd5 cxd5 10.¥d3 Eine solche Bauernstruktur hat Philidor nicht im Sinne.] 8…d5 9.e5 1.Schritt: Weiß hat eine Bauernmehrheit am Königsflügel (4-3 Bauern). Schwarz hat eine Bauernmehrheit am Damenflügel. 9…¤e8 10.¥e3 f6 11.£d2 fxe5 12.dxe5 In dem Philidorschen Übungsbeispiel hat Schwarz das Thema der Bauernmehrheit nun noch radikaler thematisiert. Wir haben jetzt Mehrheiten von 4-2 auf dem Brett.2.Schritt: Schwarz hat dem Weißen freiwillig einen Freibauern auf e5 geschaffen. 12…¥e6 Der Läufer blockiert den e-Bauern. Diese Thema wurde später bekanntlich von A.Nimzowitsch weiter bearbeitet. 13.¤f4 Der zur Blockade gut geeignete Läufer auf e6 soll abgetauscht werden. 13…£e7 14.¥xb6 axb6 15.0–0 ¤d7 16.¤xe6 £xe6 Die Dame ist kein guter Bloqueur. 17.f4 Die weiße Bauernmehrheit rückt vor. 17…¤c7 18.¦ae1 Weiß will f4-f5 spielen. 18…g6 Gegen f4-f5 gerichtet. 19.h3 Bereitet g2-g4 nebst f4-f5 vor. 19…d4 Schafft das Springer feld d5 (->e3). 20.¤e4 h6 Verhindert Se4-g5. 21.b3 Deck a2 und droht ¥d3-c4. 21…b5 22.g4 Jetzt kommt er! 22…¤d5 23.¤g3 bereitet vor f4-f5. 23…¤e3 Hilft nicht. 24.¦xe3 guter Schuß! 24…dxe3 25.£xe3 ¦xa2 26.¦e1 Deckt e5, um zum tödlichen f4-f5 zu kommen. 26…£xb3 27.£e4 auf g6 ist mehr als ein Bauer. 27…£e6 28.f5 Ja! 3.Schritt: Was lange währt, währt endlich gut. 28…gxf5 29.gxf5 Philidor hat sein Ziel erreicht. Zwei verbundene Freibauern sind nicht aufzuhalten. 29…£d5 30.£xd5+ cxd5 31.¥xb5 Die beiden weißen Freibauern laufen durch. 31…¤b6 32.f6 Er wird beide Bauern umwandeln. 32…¦b2 33.¥d3 ¢f7 34.¥f5 ¤c4 35.¤h5 bereitet vor e5-e6. 35…¦g8+ 36.¥g4 ¤d2 37.e6+ That’s it. 37…¢g6 38.f7 ¦f8 39.¤f4+ ¢g7 40.¥h5 Es gibt keine Verteidigung gegen e6-e7.
Paul Morphy
Paul Morphy wurde am 22. Juni 1837 in New Orleans als Sohn des Alonzo Morphy und seiner Ehefrau Louise Thérèse Filicite Thelcide Le Carpentier aus New Orleans geboren (David Lawson, The Pride and Sorrow of Chess, McKay, New York 1976). Sein Geburtshaus liegt in der Chartres Street Nr. 1113, die im berühmten sogenannten French Quarter von New Orleans liegt und etwa parallel zum Mississippi verläuft (Als ich 1999 in der Stadt war, habe ich dort vergebens nach einem Gedenkstein oder gar einem Denkmal für Paul Morphy gesucht. Offensichtlich hat New Orleans seinen berühmten Schachspieler vergessen).
Ähnlich wie bei Philidor tritt auch beim jungen Morphy die schachliche Begabung früh an’s Tageslicht, wird doch in der Familie Morphy ausgiebig Schach gespielt (siehe auch David Lawson, The Life of Paul Morphy, Chessworld, Jan.-Feb. 1964, S. 26 ff.). Sowohl sein Vater Alonzo als auch sein Onkel Ernest spielen Schach und Paul hat nach Angaben seines Onkels das Schach beim bloßen Zuschauen erlernt. Am 31. Oktober 1849 schrieb Ernest Morphy an Kieseritzky in Paris einen Brief, in dem er von den Schachfähigkeiten seines Neffen spricht. Kieseritzky, zu jenem Zeitpunkt Chefredakteur der Zeitung La Régence, sorgte dafür, daß die Partie zwischen Paul Morphy und Eugéne Rousseau, einem in Paris geborenen starken Schachamateur, im Januar Heft der Zeitung La Régence veröffentlicht wurde. Rousseau, der sich seinerzeit in New Orleans aufhielt (Nouvelle Orleans war 1718 von den Franzosen gegründet worden; es kam 1762 an Spanien und 1803 schließlich an die USA), ist auf dem Stich von Laemlein über den Schachkampf St. Amant vs Staunton in Paris 1843 in der rechten unteren Ecke verewigt worden (Nach Angaben von Alphonse Delannoy und anderen Zeitgenossen zeichnet sich der Stich durch ausgesprochene Detailtreue aus. Laemlein hatte jeden abgebildeten Schachamateur zu Einzelsitzungen in sein Atelier beordert, woraus die ausgesprochene Ähnlichkeit der abgebildeten Personen resultiert). Er hat gegen alle Koryphäen der Pariser Schachszene gespielt und dürfte ein starker Gegner für Paul Morphy gewesen sein.
Ernest Morphy schrieb (meine Übersetzung aus dem Französischen): „Mein lieber Herr, ich übersende Ihnen hiermit eine Schachpartie, welche am 28. Oktober des Jahres gespielt wurde von Monsieur R. (Rousseau, Anm. HB) und dem jungen Paul Morphy, meinem Neffen, der nur zwölf Jahre alt ist. Dieses Kind hat niemals ein Schachbuch geöffnet; er hat das Spiel selbst gelernt, indem er die Partien, die die Mitglieder seiner Familie gegeneinander spielten, verfolgt hat. – In den Eröffnungen, spielt er die richtigen Züge, wie intuitiv; und man ist von der Präzision seiner Berechnungen im Mittelspiel und im Endspiel erstaunt. – Vor dem Schachbrett sitzend, zeigt sein Gesicht keine Regung, selbst in den schwierigsten Positionen nicht; in diesen Fällen, bläst er etwas Luft zwischen seine Zähne und sucht mit Geduld die Kombination, die ihn aus dem Problem herausbringt. Auch spielt er drei oder vier ganz schön schwere Partien jeden Sonntag (das ist der einzige Tag an dem sein Vater ihm erlaubt zu spielen) ohne auch nur die geringste Müdigkeit zu zeigen“ (La Régence, Journal des Échecs, Troisième Année, Paris 1851, S. 23-24).
Die Partie, die der 12jährige Morphy mit Weiß gegen den etwa 41 jährigen, erfahrenen Schachspieler Rousseau spielte, ging in die Weltgeschichte des Schachs ein.
Morphy, Paul – Rousseau, Eugène [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 f5 4.d3 ¤f6 5.0–0 d6 6.¤g5 d5 7.exd5 ¤xd5 8.¤c3 ¤ce7 9.£f3 c6 10.¤ce4 fxe4 11.£f7+ ¢d7 12.£e6+ ¢c7 13.£xe5+ £d6 14.£xd6+ ¢xd6 15.¤f7+ ¢e6 16.¤xh8 exd3 17.cxd3 ¢f6 18.b4 ¥e6 19.¦e1 ¥g8 20.¥b2+ ¢g5 21.¦e5+ ¢h6 22.¥c1+ g5 23.¦xg5 1–0
Als Paul Morphy im Alter von zwanzig Jahren nach Europa kam, um sich mit den europäischen Schachmeistern messen zu können, hatte er sein juristisches Staatsexamen bereits absolviert. Er gilt als einer von zwei Menschen, die jemals das gesamte Gesetzesbuch des Staates Louisiana auswendig konnten.
Sicher ist, daß Morphy eine ganz außergewöhnliche schachliche Begabung aufwies und als zweites Wunderkind des Schach angesehen werden kann. Er hatte jedoch intuitiv lediglich eines der wichtigsten Gesetze im Schach entdeckt, nämlich die enorme Bedeutung einer schnellen Entwicklung der Figuren. Seine „Geheimwaffe“, seine „Wunderwaffe“ bestand in der schnellen Entwicklung seiner Figuren; „Wunder“ und „Geheim“, weil seine Zeitgenossen dies nicht verstanden und es war diese Waffe, die ihn über alle anderen Spieler seiner Zeit siegen ließ (Fred Reinfeld, Great Games by Chess Prodigies, Macmillan, New York 1967, S. 2).
José Raul Capablanca y Graupera
José Capablanca wurde am 19. November 1888 in Havanna, Kuba, geboren. Die Geschichte mit der Capablanca selbst erzählt (José R. Capablanca, My Chess Career, Bell and Sons, London 1920), wie er das Schachspiel erlernte ist oft wiedergegeben (I. und W. Linder, Das Schachgenie Capablanca, Sportverlag Berlin 1988, S. 9 ff.) und gelegentlich auch angezweifelt worden (Max Euwe und Lodewik Prins, Capablanca. Das Schachphänomen, Hatje Verlag, Stuttgart 1952, S. 9 ff. Euwe bzw. Prins schreiben: „Die bekannte Legende, nach der Capablanca im Alter von vier Jahren Schachspielen gelernt haben soll, als er seinem Vater, einem spanischen Leutnant, beim Spielen zweier Partien mit einem Gast zusah, ist 1920 vom Meister selbst in’s Reich der Phantasie verwiesen worden“). Edward Winter veröffentlichte eine ausführliche und lebensnahe Darstellung, die Capablanca ursprünglich für die Oktober-Ausgabe des Munsey’s Magazine 1916 schrieb (Edward Winter, Capablanca, McFarland, Jefferson 1989).
Capablanca schreibt (meine Übersetzung aus dem Englischen): „Ich erinnere mich genau an meine erste Partie Schach. Ich hatte gerade meinen vierten Geburtstag gehabt – … .es war vor 23 Jahren. ….. . … Meine Begleiter waren Soldaten; mein Spielplatz ein militärisches Fort. Hier hörte ich die Geschichten von Kriegen, strategischen Schlachten, von militärischen Helden. Hier machte der Glanz des Militärischen Eindruck auf mich. Und hier wurde mir, jung wie ich war, die für den Soldaten enorme Wichtigkeit eines gut geplanten Angriffs oder Verteidigung klar gemacht.
Als ich die Räume meines Vaters betrat, rief die Szene, die sich meinem Auge darbot, sofort Interesse hervor. Im Zentrum des Raumes saß mein Vater, seinen Kopf in die Hände stützend, mit seinen Augen gespannt auf das Brett starrend. Ihm saß in der gleichen Haltung ein Offiziersbruder gegenüber (in Chessworld May-June 1964, S. 27 ff, teilt Olga Capablanca mit, der Gegner von Capas Vater sei General Lono gewesen). Beide schienen tief nachzudenken. Keiner von beiden sagte ein Wort. Ich kam näher und sah zum ersten Mal in meinem Leben ein Schachbrett.
Ohne die Ruhe zu stören nahm ich eine Position am Tisch ein, von der ich den weiteren Fortgang auf dem Brett gut sehen konnte. Meine jungenhafte Neugier wuchs bald zum Staunen; und sehr kurz darauf, nachdem ich meinen Vater beobachtet hatte, wie er diese sonderbar geformten Figuren auf dem Brett von Feld zu Feld bewegt hatte, fühlte ich eine Faszination für das Spiel.
Das Interesse, das die zwei Soldaten zeigten, vermittelte mir den Eindruck, das Spiel habe eine militärische Bedeutung. Ich begann dann mich zu konzentrieren, um herauszufinden wie die Figuren bewegt werden; und zum Ende der ersten Partie fühlte ich mich sicher, die Regeln zur Führung der Schachfiguren gelernt zu haben.
Eine zweite Partie wurde gespielt. Zu diesem Zeitpunkt hätte ein Märchen aus Tausend und einer Nacht mich nicht mehr fesseln können. Ich folgte aufmerksam jedem Zug. Nachdem ich das erste Geheimnis im Schach – die Bewegung der Figuren – entschlüsselt hatte, versuchte ich, die Prinzipien auf denen das Spiel beruht herauszufinden.
Obwohl ich erst vier Jahre alt war, konnte ich bald sehen, daß eine Schachpartie mit einer militärischen Schlacht verglichen werden kann – etwas, das auf der Seite des einen Spielers einen Angriff beinhaltet und auf der anderen Seite eine Verteidigung. Eine Aktion dieser Art machte immer einen tiefen Eindruck auf mich. Ich erinnere mich mit welcher Freude ich eine Soldatengeschichte von der Einnahme einer Schanze oder von der Gefangennahme einer Armee hörte.
Ich glaube deshalb, daß die erste und sehr starke Anziehungskraft, die das Schachspiel auf mich ausübte, die Folge der sehr speziellen Einstellung meines Geistes, den ich in meiner militärischen Umgebung entwickelt hatte und auch einer besonderen Intuition war.
An diesem besonderen Abend ereignete sich eine Begebenheit, mit der meine Schachkarriere begann. Während der zweiten Partie, die mein Vater spielte, bemerkte ich, daß er einen seiner Springer nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise gezogen hatte – ein Zug, der anscheinend von seinem Gegner übersehen worden war. Ich blieb, wie es sich gehört, bis zum Ende der Partie still. Dann wies ich meinen Vater darauf hin, was er getan hatte.
Zuerst versuchte dieser meine Aussage mit dem typischen Verständnis eines Vaters, der etwas dummes aus dem Munde seines Kindes hört, abzutun. Meine ernstgemeinten Proteste … und der zweifelnde Blick seines Gegners, ließen ihn schließlich glauben, er könne schuldig sein, den anderen Spieler betrogen zu haben. Er wusste jedoch, daß ich niemals vorher eine Schachpartie gesehen hatte und so sagte er sehr höflich zu mir, daß er zweifele, ob ich überhaupt wüsste, was ich sagte. Ich weiß nicht, ob er glaubte, ich sei plötzlich verrückt geworden, oder ob er sich nur weitere Peinlichkeiten in der Anwesenheit seines Freundes ersparen wollte; jedenfalls setzte er sich hin, um gegen mich zu spielen und erwartete sicherlich eine frühe Kapitulation meinerseits.
Als er sah, daß ich die Figuren bewegen konnte, war er sichtlich verwirrt. Als die Partie sich dem Ende näherte, kann ich nicht sagen, ob es Verblüffung, Kränkung oder Freude war, die ihn am meisten berührte, denn ich hatte ihn in meiner allerersten Schachpartie besiegt.“ (Edward Winter, Capablanca, McFarland, 1989, S. 1 ff.).
1911, im Alter von 22 Jahren, gewann José Raoul Capablanca in San Sebastian eines der stärksten Turniere aller Zeiten. Außer dem Weltmeister Emanuel Lasker waren alle Größen der Zeit anwesend: Rubinstein, Vidmar, Marschall, Tarrasch, Schlechter, Niemzowitsch, Bernstein, Spielmann, Teichmann, Maroczy, Janowsky, Duras, Burn und Leonhardt. Der I. Weltkrieg verhinderte einen Kampf um die Weltmeisterschaft. Das Wunderkind sollte ihn schließlich im Jahre 1921 in Havanna gegen Emanuel Lasker gewinnen.
Capablanca ist das Wunderkind, für das nach meinem Dafürhalten dieser Terminus noch am wahrhaftigsten zutrifft. Capablancas Begabung und Einsicht in die Zusammenhänge auf dem Brett, welche nicht hart erarbeitet, sondern von der Natur ihm mit auf den Weg gegeben worden waren, wurden von keinem anderen Spieler jemals wieder gezeigt.
Samuel Reshevsky
Samuel Herman Reshevsky wurde am 26.11.1911 in einem Vorort von Lodz in Polen als jüngstes von sechs Kindern geboren (Interview Hanon Russell mit S. Reshevsky im Dezember 1989 siehe http://www.chesscafe.com). Ähnlich wie bei Capablanca existieren auch von Reschewsky Mitteilungen, wie er das Schachspiel in früher Kindheit erlernte (Samuel Reshevsky, Reshevsky on Chess, Pitman London 1948. Nach Ken. Whyld, Oxford Companion to Chess 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford 1992, S. 336 wurde das Buch mit Hilfe von Fred Reinfeld geschrieben).
Ein gute Übersetzung in’s Deutsche (Samuel Reshevsky, Meine Schachkarriere, Walter de Gruyter, Berlin 1957) erstellte im Jahre 1957 Rudolf Teschner, aus der ich hier zitiere:
„Im Alter von acht Jahren weltweiten Ruhm zu erwerben, ist kein reiner Segen. Dieses Los war mir bestimmt. Ich war ein „Schachwunderkind“, und meine Kindheit, von der Zeit an, als ich meine polnische Heimat 1920 verließ, bestand aus einer Kette öffentlicher Vorstellungen in Europa und den Vereinigten Staaten. Wohin ich auch ging, überall erschienen viele Zuschauer, die mich spielen sehen wollten. Vier Jahre lang stand ich im Licht der Öffentlichkeit. Die Leute betrachteten mich, befühlten mich, versuchten mich zu liebkosen, stellten Fragen. Professoren maßen meinen Schädel und psychoanalysierten mich. Reporter kamen zum lnterview und schrieben phantasievolle Geschichten über meine Zukunft. Ständig hatten die Photographen ihre Kameras auf mich gerichtet.“ (Franziska Baumgarten führte 1920 verschiedene Experimente mit Reschewsky, wie Rechnen, Zusammensetzen von geometrischen Figuren aus Teilen, Gedächtnistest für Zahlen, Merkfähigkeit für Figuren, Binet-Simon-Intelligenztest durch. In sämtlichen Leistungen zeigte R. nur mäßige bis durchschnittliche Leistungen mit einer Ausnahme: er war imstande, nach 4 Minuten 40 Zahlen auswendig zu lernen, die in einem 5 mal 8 Quadrat standen und konnte auch deren genaue Lage angeben. Zitiert nach Roland Arbinger, Schach und Psychologie in: Schach-Echo Nr. 18, Königstein i. Ts. 1972).
„Das war natürlich ein unnatürliches Leben für ein Kind, aber es hatte auch sein Gutes, und ich kann nicht sagen, daß ich es nicht schön fand. Da gab es das Erlebnis des Reisens von Stadt zu Stadt mit meiner Familie, das aufregende Spielen von Hunderten von Schachpartien und das Gewinnen der meisten, das Bewußtsein, daß es etwas „Besonderes“ mit der Art, wie ich Schach spielte, auf sich hatte, obwohl ich nicht wußte warum.
Ich werde ständig gefragt, wie es möglich war, daß ich als Kind so stark Schach spielte. Natürlich wußte ich keine Antwort. Ich konnte singen, und ich konnte radfahren, und ich konnte schachspielen, aber ich wußte nicht, wie oder weshalb ich diese Fähigkeiten besaß. Ich sang, weil es mir Spaß machte zu singen -und ich spielte Schach, weil es mir Freude bereitete. Das war alles, was ich wußte.
Ich hatte das Spiel nie studiert. Ich war dazu zu jung. Ich griff es auf beim Zusehen, wie mein Vater zu Hause spielte. Als ich vier Jahre alt war, spielte ich gut genug, um die meisten Spieler in unserem Ort zu schlagen. Mit sechs Jahren hatte ich bereits mit vielen polnischen Meistern in Lodz und Warschau gespielt, unter denen sich auch Großmeister Akiba Rubinstein befand, und mein Ruf hatte sich in Polen durch die Abhaltung von Simultanvorstellungen in den führenden Städten verbreitet.
1920, acht Jahre alt, begann meine Karriere als „Schachwunderknabe“ ernstlich. Begleitet von meinen Eltern bereiste ich die Hauptstädte Europas und gab Vorstellungen in Berlin, Wien, Paris, London und anderen Städten.
Am 3. November 1920 kam ich mit meinen Eltern in New York an und wurde unmittelbar zum Marshall-Schachklub gebracht, wo ich den damaligen Champion der Vereinigten Staaten, Großmeister Frank J. Marshall und A. B. Hodges, einen früheren Champion, traf.“ (In Hanon Russells Interview (a.a.O.) sagte Reschewsky 1989 auf die Frage, wie er Schach gelernt habe:„Nobody taught me. My father used to play with his neighbors and after watching for about two weeks, I saw him resign. When he did that, I popped up and I said, ‚Dad, let me take over your position’. He said, „OK.“ I took over the position and I won the game. That was the beginning“).
Die Eltern des kleinen Reschewsky machten sich das Talent ihres Sohnes zu nutze und gingen mit ihm auf Tournee durch ganz Europa. In Amerika reiste die Familie während zwei Jahren durch das Land und Sammy verdiente durch sein Spiel viel Geld. Ende 1922/Anfang 1923 wurden seine Eltern angeklagt wegen „improper guardianship“. Die Anklage wurde zwar fallengelassen, aber ein Erzieher wurde beauftragt „übermäßige Ausbeutung“ zu verhindern (David Hooper und Kenneth Whyld, Oxford Companion to Chess, 2nd Ed., London, S. 335).
Der Aufenthalt des Kleinen in den Vereinigten Staaten wurde auch von Charlie Chaplin beobachtet. Charlie Chaplin schreibt in seiner Autobiographie (Die Geschichte meines Lebens, Fischer Taschenbuch 1936, S. 217 ff.):„Während ‚The Kid’ geschnitten wurde, besuchte der siebenjährige Samuel Reschewsky, der Kinderschachweltmeister, das Atelier. Er sollte im Athletic Club seine Künste zeigen und eine Simultanpartie gegen zwanzig Erwachsene spielen, darunter Dr. Griffiths, den Schachmeister von Kalifornien. Er hatte ein dünnes, blasses, eindringliches kleines Gesicht und starrte die Menschen, denen er begegnete, aus großen Augen streitsüchtig an. Man hatte mir schon gesagt, daß er launisch sei und kaum jemandem die Hand reiche. … .
„Können Sie Schach spielen?“, fragte er. Ich mußte zugeben, daß ich es nicht konnte. „Ich zeige es Ihnen, kommen Sie doch heute abend und sehen Sie mir zu. Ich werde gleichzeitig mit zwanzig Männern spielen“, sagte er prahlerisch. Ich versprach es und sagte, ich würde ihn hinterher zum Essen ausführen.“ … . „Man mußte nicht unbedingt Schachspieler sein, um das Drama dieses Abends wahrzunehmen: Zwanzig Männer mittleren Alters über ihrem Schachbrett brüten zu sehen, in Ratlosigkeit gestürzt von einem Siebenjährigen, der noch dazu jünger aussah als er war, und ihn zu beobachten, wie er an dem U-förmig angeordneten Tisch von einem Brett zum anderen ging, war allein schon dramatisch genug. Die dreihundert oder mehr Zuschauer, die schweigend auf den Bankreihen an den Längswänden der Halle saßen und ein Kind beobachteten, das seine Geisteskraft mit der erfahrener Männer maß, wirkten surrealistisch. Einige von ihnen schauten herablassend lächelnd zu. Der Junge war verblüffend, doch beunruhigte er mich, denn als ich das konzentrierte kleine Gesicht betrachtete, einmal stark gerötet und dann wieder kreidebleich, wußte ich, daß der Junge mit seiner Gesundheit bezahlte … .“.
Entgegen der Befürchtung Chaplins hat die sehr frühe und intensive Beschäftigung mit dem Schachspiel Reschewskys Gesundheit wohl nicht sehr geschadet, denn Reschewsky verstarb 1992 im biblischen Alter von achtzig Jahren (Stephen W. Gordon, Samuel Reshevsky, McFarland, 1997, S. 1. Der exakte Geburtstag R.s ist nicht ganz sicher). Brian Harley (Chess and its Stars, Whitehead and Miller, Leeds 1936, S. 67-74) berichtet in seinem Büchlein über den jungen Reschewsky und bringt dabei auch ein Photo, das Chaplin und Reschewsky am Brett zeigt. Harley erklärt auch, weshalb Reschewsky zur Begrüßung selten die Hand gab.
Ich bringe hier nur einen kleinen Auszug, den ich sinngemäß aus dem Englischen übersetze, wobei die Ähnlichkeit mit der Schilderung Chaplins unverkennbar ist: „Nach den Einführungen setzte sich Samuel … und beobachtete die Gesellschaft mit gelangweilter Miene. Samuel kann nur zwei oder drei Worte Englisch und es war hier, daß der Übersetzer seine Fähigkeiten zeigte. Zuallererst lernt man, daß der Junge ein sehr orthodoxer Jude aus der Hassidim Sekte ist. Es ist ihm verboten, Frauen seiner eigenen Glaubensrichtung die Hand zu geben, aber Samuel will nichts riskieren und dehnt seine Ablehnung auf hübsche Nichtjuden aus. Dies hatte in Paris einiges Ärgernis verursacht …. „.
Es fällt auf, daß von den Zeitgenossen der 20er Jahre lediglich Tarrasch kritisch gegenüber den schachlichen Leistungen des sogenannten Wunderkindes war. Er war nicht sehr beeindruckt vom Können des Achtjährigen, sondern banalisierte das vermeintlich wunderbare, indem er auf die Möglichkeit der Erlernbarkeit des Schachspiels hinwies. In den Münchner Neuesten Nachrichten (MNN Nr. 73, 1920) schrieb er: „Das achtjährige Schachwunderkind S. Reszewski erregt gegenwärtig in Berlin großes Aufsehen, wie wir bereits an anderer Stelle mitgeteilt haben. An sich betrachtet, also ohne Berücksichtigung seines Alters, sind seine Leistungen keineswegs hervorragend, wie aus der folgenden Partie hervorgeht, die er ohne Ansicht von Brett und Figuren gegen den bekannten Meister C. v. Bardeleben gespielt hat. Eine wirkliche Talentprobe dagegen hat der Kleine in einer Partie gegen einen der besten Berliner Amateure, Herrn Sämisch, gegeben. Die ganze Partie hat der Kleine nicht gut gespielt, aber das Damenopfer ist hübsch und überraschend und verrät Talent. – Auch der Versuch des Wunderkindes, sich im Massenspiel gegen 20 oder 22 Gegner zu produzieren, muß als gescheitert betrachtet werden. Nach fünfstündigem Spiel waren nur sechs Partien beendet, die übrigen Partien mußten abgeschätzt werden. Damit war die Vorstellung mißlungen, obwohl der Kleine die sechs beendeten Partien gewonnen hat und in der Mehrzahl der anderen besser stand. Beim Simultanspiel kommt es eben darauf an, rasch zu spielen. Eine Vorstellung von 20 Partien muß in 3 – 4 Stunden beendet sein.
An sich also sind die Leistungen des achtjährigen Wunderkindes nicht hervorragend. Vor vier Jahren übrigens, bei seinem ersten Auftreten in Warschau, zählte es sechs Jahre; Wunderkinder altern langsam. Bleibt also nur die Jugend zu bewundern. Ein kleines Kind spielt Schach; es stümpert nicht, sondern spielt wirklich Schach wie ein Erwachsener und mit Erwachsenen; da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich! Nach meiner Ansicht ist es nicht schwer, ein gut begabtes Kind im Alter von 5-6 Jahren, wenn man es auf alles andere verzichten läßt, im Schach so auszubilden, daß es dieses schwierige Spiel versteht und mittelmäßig spielen kann. Und nun ist der Kleine offenbar in den letzten Jahren äußerst fleißig trainiert worden, was man an seinen Eröffnungen merkt. Bei der ganzen Sache finde ich nichts Wunderbares. Es hat einmal ein Schachwunderkind gegeben, das im Alter von 12 Jahren schon meisterhaft spielte; das war der berühmte Paul Morphy, der später alles niederwarf, was sich ihm entgegenstellte. Von ihm will ich in der nächsten Nummer eine Partie bringen, die er im Alter von 12 Jahren blindlings spielte. Welch eine Fülle von Ideen, welche Genialität der Spielführung schon damals! Davon ist bei dem neuen Wunderkind vorläufig nicht viel zu merken. Aber vielleicht entwickelt es sich noch! Einseitiges Training vermag Wunder zu wirken.“
Tarrasch beleuchtete das „Wunderkind“-Phänomen in pointierter und amüsanter Weise und traf dabei den Nagel auf den Kopf. Der Text könnte auf so manches sogenannte Wunderkind unserer Tage zutreffen. Bekanntlich hat spätestens Laszlo Polgar, Budapest, den Nachweis erbracht, daß sehr gute und gute schachliche Leistungen mit sehr früher und kontinuierlicher Trainingsarbeit erzielt werden können.
Samuel Reschewsky stellt in idealtypischer Weise das Bindeglied zwischen den Schachwunderkindern alter Tage und den talentierten Spielern unserer Tage dar. Einerseits haben die Eltern Reschewskys die zu pekuniären Zwecken unternommene, ausgiebige Reisetätigkeit der Familie Polgar (Laszlo Polgar et al., Le Phénomene Polgar ou l’art de former des génies, La Renaissance du Livre, Belgien 1991) und auch die spezielle Ausbildung zum Schachspiel vorweggenommen. Andererseits bietet die Geschichte der Familie Polgar gleichzeitig auch den Übergang zu den anderen „Wunderkindern“ der Neuzeit, die durch die Ausnutzung lerntheoretischer Konzepte und Trainingsmethoden in der frühen Kindheit, wie sie u.a. die sowjetische Schachschule unter Führung Michail Botwinniks entwickelte, schachliche Höchstleistungen vollbringen. Die perfektionierte und generalstabsmäßige Durchführung des „pädagogischen“ Projekts „Genieerziehung“ von Laszlo Polgar haben bei den Polgarschwestern tatsächlich zu phantastischen schachlichen Leistungen in der Kindheit geführt.
Die Polgarschwestern sind Übergang und Kulminationspunkt in einem, denn pädagogisch auf den Erkenntnissen der Neuzeit aufbauend, entzauberten sie den Mythos vom Schachwunderkind.